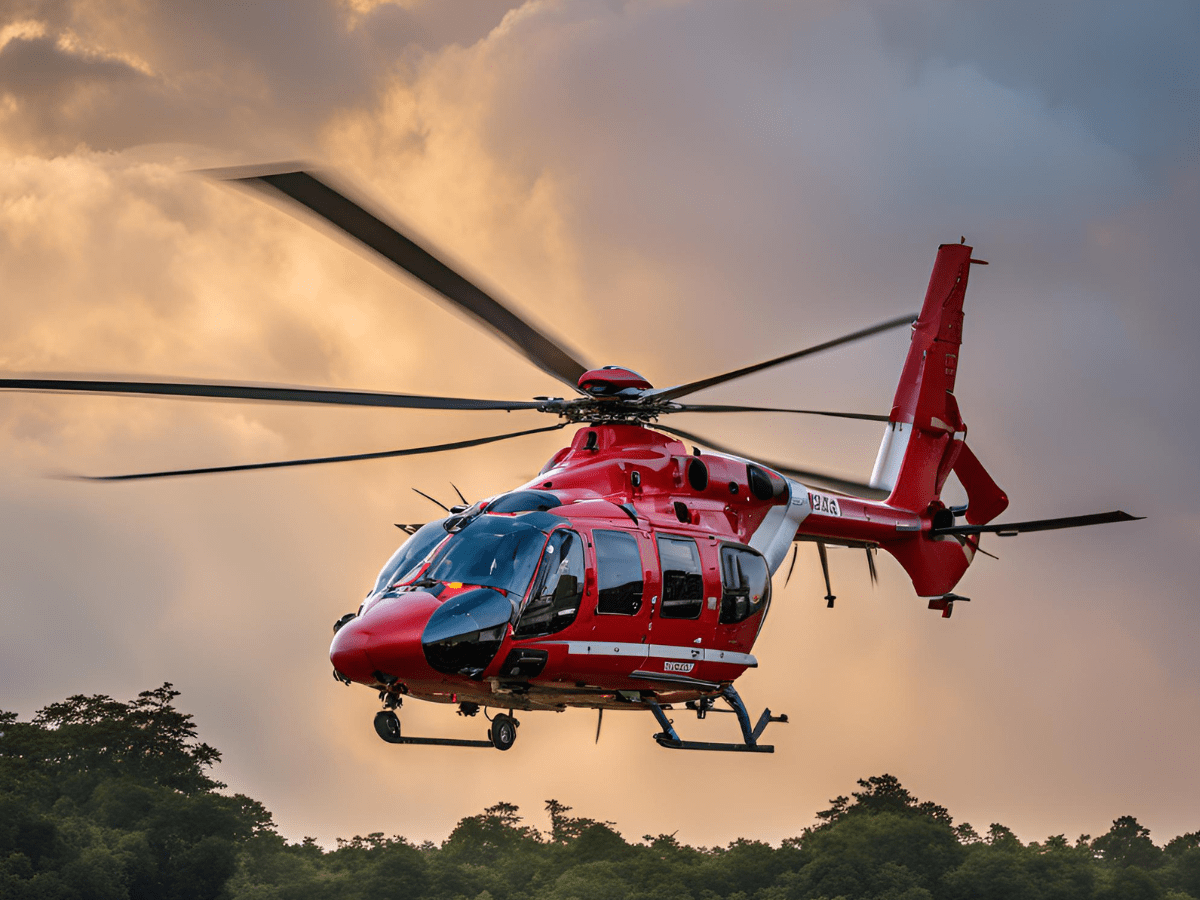Die Notfallreform, die 2025 in Kraft treten soll, sieht Akutleitstellen und Integrierte Notfallzentren (INZ) vor, die Hilfesuchende schneller vermitteln und Notfalleinrichtungen effizienter nutzen sollen. Im Interview mit Prof. Dr. Jan-Thorsten Gräsner, Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und Sprecher der Sektion Notfallmedizin innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), ging es auf dem Jahreskongress um Notrufnummern, erhöhtem Personalbedarf auf KV-Seite,Telemedizin und Pantoffelwachen.

Franka Struve-Waasner: Die Stellungnahme des BDA (Berufsverband der Deutschen Anästhesistinnen und Anästhesisten) kritisiert die unzureichende Vorbereitung auf den erhöhten Personalbedarf im KV-Bereich durch die Ausweitung der vertragsärztlichen Erstversorgung. Welche Strategien können zur Deckung dieses zusätzlichen Personalbedarfs entwickelt werden?
Prof. Jan-Thorsten Gräsner: Es geht darum, dass wir die richtigen Patienten zu den richtigen Versorgungseinrichtungen zuführen und dass wir tatsächlich auch abstufen mit dem, was man an Versorgung anbietet. Also es muss nicht immer das Krankenhaus sein, es muss nicht immer die sofortige Aufsuchung in einer Praxis sein, sondern es gibt vielleicht auch in der Eigenkompetenz der Bürger und Gesundheitskompetenz noch mal einen Ansatz zu sagen: Mit was gehe ich denn wirklich ins Krankenhaus, mit was gehe ich denn wirklich zum kassenärztlichen Arzt und für was rufe ich den Rettungsdienst?
Franka Struve-Waasner: Wo sehen Sie die Ersteinschätzung? Wird die bei der Leitstelle sein oder wird die in der integrierten Notaufnahme im Krankenhaus sein?
Prof. Jan-Thorsten Gräsner: Wir werden beides brauchen, weil wir Patienten haben, die direkt in die Notaufnahmen gehen, dort dann eingestuft werden müssen. Wir haben beim Rettungsdienst das Problem, dass wir eine sehr hohe Anzahl an Patienten haben, für die der Rettungsdienst mit seinen Versorgungsangeboten nicht passend ist. Über ein gestuftes und adaptiertes Einstufungssystem können diese Hilfesuchenden vielleicht auch anderen Versorgungseinrichtungen – Stichwort kassenärztlicher Bereitschaftsdienst – zugeführt werden. Oder wir bieten andere Lösungen als die bisherigen – KV Arzt auf der einen Seite, Rettungswagen auf der anderen Seite – , indem man einfach noch mehr Antworten parat hat, die vorbeugend tätig sein können, die vielleicht auch niederschwellige Angebote sind, sei es der aufsuchende Dienst oder eine psychologische Behandlung reicht und man muss gar keinen Rettungswagen schicken.
Franka Struve-Waasner: Welche Rolle spielt die Telemedizin? Man kann ja auch sagen, man kann das alles online machen. Braucht es überhaupt noch einen Arzt?
Prof. Jan-Thorsten Gräsner: Telemedizin ist ein spannender Punkt, und zwar nicht nur für die Notfallmedizin, wo wir sie ja als Tele-Notarztsystem haben. Wir können damit auch die Leitstellen im direkten Kontakt zu den Patienten unterstützen. Vielleicht bekommen wir in Zukunft eine eins-zu-eins Kommunikation mit den Patienten hin, auch in der Notfallsituation, um einzuschätzen. Das kennen wir aus der Corona-Pandemie noch mit den niedergelassenen Kollegen, die eben auch über Telemedizin Dinge abarbeiten können. Wir haben ja nicht nur die alten Patienten, sondern wir haben auch junge Patienten, die an Zoom und Co gewöhnt sind und die vielleicht einfach nur eine schnelle, fundierte Meinung wollen und damit sehr gut über telemedizinische Unterstützung ihren Bedarf an medizinischer Beratung gedeckt bekommen. Und das kann sowohl ärztlicher als auch pflegerischer sein.
112 versus 116117
Franka Struve-Waasner: Die Notrufnummer 112 ist bereits gut etabliert, während 116 117 nicht in gleichem Maße bekannt ist. Welche Rolle sollte Ihrer Meinung nach die 116 117 in der Notfallversorgung spielen und wie kann die Bekanntheit dieser Nummer verbessert werden?
Prof. Jan-Thorsten Gräsner: Es gibt ja genügend Initiativen, die 116 117 auf dem Markt zu bekommen und bekannt zu machen. Aber vielleicht überfordern wir den Bürger mit zu vielen Nummer. Was wir brauchen, ist eine Anlaufstelle: Handelt es sich um einen Fall für den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder ist es ein Notfall? Wenn wir die 112 als erste Nummer etablierten, bringt das für die Rettungsleitstelle erstmal mehr Arbeit. Aber wenn ich dann relativ zügig nach einem standardisierten Verfahren feststelle: Das ist gar nicht mein Fall, dann landet es eben bei der zuständigen Antwort. Vielleicht brauchen wir eine Gesundheitsleitstelle unter einer Rufnummer. Und da gibt es mehrere Ansätze: Die einen sagen: Lass uns mit 116 117 anfangen und dann von niederschwelligen Beschwerden nach oben gehen bis zum akuten Notfall. Die anderen sagen: Lass uns oben einsteigen. Und wenn ich merke, ich brauche weniger dringend eine Behandlung, kann ich nach unten durchreichen. Für beide Positionen gibt es gute Argumente. Aus der reinen Notfallmedizin-Sicht gefällt mir das Letztere natürlich besser. Man hat steigt oben mit der 112 ein und geht dann runter.
Franka Struve-Waasner: Welche langfristigen Auswirkungen erwarten Sie durch die geplante Reform auf die Struktur und Qualität der Notfallversorgung?
Prof. Jan-Thorsten Gräsner: Bei einer Reduktion von Kliniken werden wir längere Transportwege für die Patienten bekommen. Was aber aus Sicht eines Notfallmediziner und vielleicht auch aus der Sicht einer Universitätsklinik in Ordnung ist. Wir können nicht an jedem Bereich, an jeder Ecke, die maximale Therapie vorhalten. Wenn wir hohe Qualität wollen und wir diese Qualität nicht erreichen, indem wir in bestimmten kleinen Krankenhäusern bestimmte Maßnahmen nur sehr selten anwenden, heißt das also Spezialisierung und Zentrenbildung. Zum Beispiel Reanimation: Die Patienten müssen in das richtige Krankenhaus und nicht in irgendein Krankenhaus, nur weil es sehr schnell erreicht werden kann. Beim erstbesten Krankenhaus ist nach zehn Minuten der Rettungsdienst wieder frei. Aber der Patient hat mehr davon, wenn man ihn eine halbe Stunde transportiert ins richtige Krankenhaus. Dafür muss der Rettungsdienst aber auch in der Lage sein, erstens in technischer, aber auch personell und mit dem Wissensstand beim Patienten, dass vielleicht auch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Transport in einem kritischen Zustand sinnvoll ist. Die Krankenhausreform wird eine Veränderung der Landschaft mit sich bringen. Wir werden eine Spezialisierung kriegen, aber der Rettungsdienst muss immer mitgedacht werden, sonst funktioniert es nicht. Unser Ziel ist den richtigen Patienten zur richtigen Zeit ins richtige Krankenhaus zu bringen.
Franka Struve-Waasner: Wie ist denn das mit der Rechtssicherheit für die Entscheider in der Leitstelle? Ich bin keine Juristin, aber ich würde lieber den Rettungswagen schicken, weil dann bin ich selbst aus der Haftung bin.
Prof. Jan-Thorsten Gräsner: Wir haben im Moment Hilfsfristen, die eingehalten werden müssen. Wenn diese eingehalten werden sollen, schickt man das Fahrzeug, was am Ende verfügbar ist. Aber natürlich wird man im Zweifelsfall eher sagen: Ich schicke den höherwertigen Dienst, wenn ich nicht sicher bin, als zu niedrig. Hier bedarf es Änderungen, weil wir von den Rettungsmittel mit einem hohen Level nicht genug haben. Die Zeiten sind vorbei, in denen einfach ausgeliefert wurde: Wenn ich jetzt mit zehn Rettungswagen nicht auskomme, dann brauche ich im nächsten Jahr zwölf. Kein Problem. Zur Erinnerung: Geld fährt keine Autos und auf den Fahrzeugen muss ausgebildetes Personal sitzen. Und wenn das ausgebildete Personal nicht da ist, kann diese Strategie – ich schicke einfach mehr vom Gleichen – nicht mehr funktionieren. Die Lösungen der letzten 30 Jahre sind vorbei. Die funktionieren nicht mehr.
Ausstattung der Rettungswagen
Franka Struve-Waasner: Wie schaut es aus mit dem Equipment des Rettungswagens aus? Es gibt die Überlegung, dass man ein kleines Krankenhaus im Rettungswagen auf Rädern herumfährt.
Prof. Jan-Thorsten Gräsner: Das haben wir doch schon. Wir müssen nur mit dem kleinen Krankenhaus, dem Rettungswagen, auch umgehen können und müssen auch die Sachen, die dort machbar sind, machen. Vielleicht ist es nicht nur das kleine Krankenhaus im Rettungswagen, sondern vielleicht ist es die kleine Arztpraxis im Rettungswagen, die dann aber auch fallabschließend draußen einen Fall beenden kann. Auch die Trennung zwischen Notarztdienst und kassenärztlichen Notdienst ist hinderlich: Wenn ich als Notarzt zu einem Patienten komme, der meine Hilfe als Notarzt nicht braucht, aber ein Medikament braucht, dann muss der kassenärztliche Arzt kommen, um zu verschreiben, weil wir als Notärzte ja nicht dem Kassenärztlichen Dienst unterstehen und damit zum Beispiel keine AU oder kein Rezept ausstellen können. Aber ich bin ja schon da, ich bin Arzt. Also von der Idee wäre es gut zu sagen: Ich muss das System nicht noch mal aktivieren für eine Verschreibung von Tabletten, sondern wenn ich die mit verschreiben könnte, wäre ja schon ein Teil des Systems, in diesem Fall der kassenärztliche Dienst entlastet, der dann für andere Einsätze wieder da wäre.
Franka Struve-Waasner: Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen in ländlichen Gebieten im Vergleich zu städtischen Regionen?
Prof. Jan-Thorsten Gräsner: Wir werden weiterhin hochqualitative notfallmedizinische Versorgung in den ländlichen Gebieten brauchen. Wir werden vielleicht in den städtischen Gebieten gar nicht so viele notärztliche Versorgung brauchen, wie wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, sondern können dort auch mit Telemedizin unterstützen. Wichtig dabei ist: Die hoch kompetente notärztliche Versorgung brauche ich schnell, das heißt, ich werde auch Pantoffelwachen haben, wo man einen Einsatz am Tag fährt, aber die werden trotzdem ihre Berechtigung haben, während in der Stadt vielleicht der Notarzt für manche Dinge gar nicht mehr der zweite, dritte Notarzt zum Hilfesuchenden muss, weil das der Tele-Notarzt erledigen kann und der dann verbliebene Notarzt für die invasiven Maßnahmen bei kritisch kranken Patienten zur Verfügung steht.
Franka Struve-Waasner: Wie bewerten Sie die sektorenübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem Rettungsdienst und der vertragsärztlichen Versorgung?
Prof. Jan-Thorsten Gräsner: Ausbaufähig.
Franka Struve-Waasner: Wie soll die sektorübergreifende Zusammenarbeit verbessert werden?
Prof. Jan-Thorsten Gräsner: Über Vernetzung. Wir brauchen unterschiedliche Antwortmöglichkeiten auf die Patientenanfrage. Der Patient kommt mit seinem Problem. Der definiert seine Sorge. Aber wir müssen die Antwort definieren. Es kann nicht sein, dass der Patient entscheidet, dass er einen Rettungswagen haben will. Auch solche Anrufe gibt es in der Leitstelle. „Schicken Sie mir einen Hubschrauber!“ Es sollte vielmehr so sein: Der Patient definiert seinen Bedarf; Die Gesundheitsleitstelle oder eine Vernetzung, die wir dafür einrichten, definiert die Antwort. Diese können unterschiedlich ausfallen: „eine halbe Stunde Gespräch mit Psychologen, jetzt und sofort“ oder „Terminvergabe beim Hausarzt für nächste Woche“ oder „Gehen Sie zur Apotheke und holen Sie sich folgendes Medikament…“ Die kann aber auch heißen: „Wir schicken die Kavallerie – sprich: den Rettungswagen und den Notarzt- mit allem, was wir haben, weil es ein Kreislaufstillstand ist. Und die Antworten müssen mehr sein oder breiter sein als das, was wir jetzt haben. Mehr vom Selben funktioniert nicht, weil es auch dem Bedarf des Patienten nicht gerecht wird: Mehr Rettungswagen, mehr Kassenärzte braucht es nicht. Die Antwort wird nicht greifen, wenn der Patient vielleicht manchmal nur einen Termin für eine Untersuchung benötigt. Er braucht vielleicht manchmal nur einen Hinweis auf eine Apotheke. Das heißt, diesen Gesundheitsleitstellen kommt eine ganz neue Kompetenz zu. Und die Akteure, die ich habe, muss ich mit allem, was Gesundheit betrifft, damit vernetzen können. Sonst habe ich wieder Parallelität und der Patient weiß nicht, was die Antwort auf sein Problem ist. Der definiert sein Problem. Die Antwort müssen wir geben.
Vielen Dank für das Gespräch.